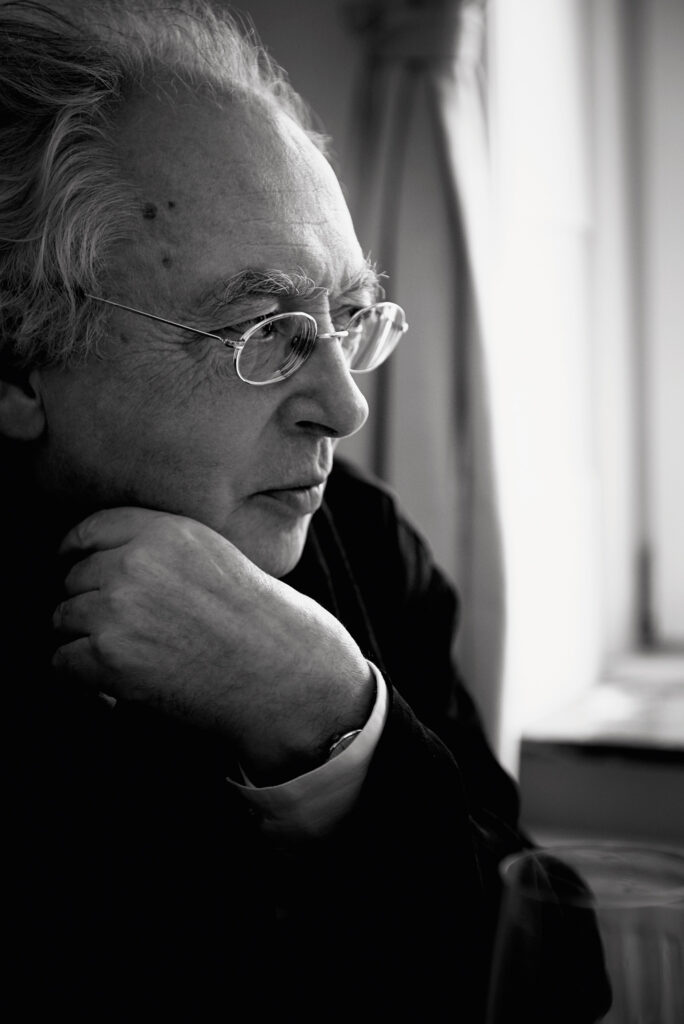18.45 Uhr Konzerteinführung im Saal Bodensee
19.30 Uhr Großer Saal
Das gesamte Jahresprogramm 2025/2026 können Sie hier digital ansehen.
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Dritte Sinfonie in Es-Dur Opus 55
„Eroica“
- Allegro con brio
- Marcia funebre: Adagio assai
- Scherzo: Allegro vivace
- Finale: Allegro molto
Luigi Cherubini (1760 – 1842)
Requiem in c-Moll
Introitus et Kyrie
Graduale
Dies irae
Offertorium
Sanctus et Benedictus
Pie Jesu
Agnus Dei
Dauer: ungefähr 120 Minuten
Beethovens „Eroica“ – im Gedenken an einen Helden
Hatte Beethoven sich in seinen beiden ersten Sinfonien noch, wenn auch mit seinem bereits unverkennbaren eigenen Ton, an seinen großen Vorgängern Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart orientiert, so beschreitet er mit seiner Dritte Sinfonie ganz neue Wege. Diese bestehen nicht etwa im Verlassen der gängigen Form, etwa der Viersätzigkeit. Vielmehr geschieht diese Neuerung von innen heraus. Themen werden satzübergreifend eingesetzt, Binnenstrukturen mit Bedeutung aufgeladen. Unverkennbar ist ein subjektiver Ton, der außermusikalische Inhalte erahnen lässt und der weit in die Epoche der Romantik weist. „Reden an die Menschheit“ hat man Beethovens Sinfonien genannt. Ganz bestimmt gilt dies für die Eroica. Die Rezensenten, die den ersten Aufführungen – die Uraufführung fand im April 1805 statt – beiwohnten, verstanden sehr wohl, dass sie hier einem großartigen Werk gegenüberstanden, fanden aber auch Worte wie „Bizzarerie“ oder „Regellosigkeit“. Allein die Spieldauer von etwa fünfzig Minuten war für damalige Zeiten ungewöhnlich.
Bis heute beschäftigt sehr wohl die Entstehung der Eroica wie auch ihre Deutung die Gemüter. Was erstere betrifft, so wird gerne die Geschichte erzählt, die der Sekretär und Freund Beethovens, Ferdinand Ries, wie folgt berichtet:
„Bei dieser Symphonie hatte Beethoven sich Buonaparte gedacht, aber diesen, als er noch erster Consul war. Beethoven schätzte ihn damals außerordentlich hoch und verglich ihn mit den größten römischen Consuln. Sowohl ich, als auch mehrere seiner näheren Freunde, haben diese Symphonie schon in Partitur abgeschrieben, auf seinem Tisch liegen gesehen, wo ganz oben auf dem Titelblatt das Wort „Buonaparte“, und ganz unten „Ludwig van Beethoven“ stand, aber kein Wort mehr. Ob und womit die Lücke ausgefüllt werden sollte, weiß ich nicht. Ich war der erste, der ihm die Nachricht brachte, dass Buonaparte sich zum Kaiser erklärt habe, worauf er in Wut geriet und ausrief: „Ist der auch nichts anderes als ein gewöhnlicher Mensch! Nun wird er auch alle Menschenrechte mit Füßen treten, nur seinem Ehrgeiz frönen; er wird sich nun höher stellen als alle anderen, ein Tyrann werden!“ Beethoven ging an den Tisch, fasste das Titelblatt oben an, riss es ganz durch und warf es auf die Erde. Die erste Seite wurde neu geschrieben und nun erst erhielt die Symphonie den Titel: Sinfonia eroica.“ Dennoch finden sich auf Abschriften und in Briefen auch danach immer wieder Hinweise, dass „Buonaparte“ in Zusammenhang mit der „Dritten“ Beethovens eine gewisse Rolle spielte. Schließlich finden wir in der Überschrift der ersten Londoner Partiturausgabe von 1809 den Hinweis auf einen unbekannten Helden („Sinfonia Eroica composta per celebrare la morte d’un Eroe“ bzw. später „per festeggiare il sovvenire di un grand’uomo“). Diskutiert wird neben Napoleon auch der von den Zeitgenossen als heldenhaft verehrte Prinz Louis Ferdinand von Preußen, der 1806 auf dem Schlachtfeld gegen die französischen Truppen sein Leben ließ. Beethoven hatte den Prinzen bei Fürst Lobkowitz, der der offizielle Widmungsträger der Sinfonie ist, noch kennengelernt.
Doch letztlich ist auch die Zueignung an einen imaginären Helden nicht auszuschließen. Und da gibt es im 20. Jahrhundert zwei interessante Deutungsversuche. Ausgehend von der Tatsache, dass das Thema des vierten Satzes der Sinfonie identisch ist mit dem Hauptthema von Beethovens Ballettmusik Die Geschöpfe des Prometheus Opus 43, entwickelten die Musikwissenschaftler Constantin Floros und Peter Schleunig die Theorie, dass die gesamte Sinfonie inspiriert ist vom Mythos dieses Helden, der den Göttern trotzt.
Noch überzeugender ist die Theorie Arnold Scherings, dass der Eroica Szenen aus Homers Ilias zugrunde liegen. Demnach schildert das Fanfarenmotiv des ersten Satzes die Kraft des Helden Patroklos, den Freund des Achilles, eine Episode in e-Moll, aber auch dessen Scheitern. Er fällt im Kampf, und so erleben wir im zweiten Satz, der Marcia funebre, seine Trauerfeier samt einiger, teils freudvoller Rückerinnerungen. Der dritte Satz führt uns die Reiterspiele zu seinen Ehren vor Augen. Das Finale schließlich, ein überaus kunstvoll gebauter Variationensatz, bewegt sich von der Ilias weg. Er ist formal gehalten vom Prometheus-Motiv, welches ein englischer Kontradance ist, und England war zu dieser Zeit ein Vorreiter der Demokratie. Dazu tauchen immer wieder Fragmente von Volkstänzen aus ganz Europa auf, darunter etwa ein ungarischer Verbunkos. Hat hier Beethoven seine Vision eines geeinten Europas in Töne gefasst? Ein großer und aktueller Gedanke wäre das!
Ich habe mir erlaubt, die Theorie Arnold Scherings vergleichsweise ausführlich zu schildern, weil Nikolaus Harnoncourt, der Mentor Philipp Herreweghes, von dieser Theorie überzeugt war und diese den Musikern bei den Proben detailgenau erklärt hat.
Beethoven und Frankreich
Wie viele wache Geister hat Beethoven die politischen Vorgänge zu seiner Zeit in Frankreich aufmerksam verfolgt, also die Französische Revolution von 1789 und ihre Folgen. Mehr als das, Beethoven war an der französischen Kultur generell interessiert und plante sogar, um die Zeit der Komposition der Eroica, nach Paris zu übersiedeln. Wie wir wissen, hat er das nie in die Tat umgesetzt. Neben den soeben geschilderten Geschichten um die Dritte Sinfonie denken wir bei Beethovens Frankophilie vor allem an die Oper Fidelio, deren Libretto auf einem Text von Jean Nicholas Bouilly beruht. Dieser war ein Rechtsgelehrter und Literat. Sein Textbuch zur Oper Leonore, bei Beethoven schließlich Fidelio genannt, beruht auf einer dem Vernehmen nach wahren Begebenheit und wurde auch von Pierre Gaveaux, Simon Mayr und Ferdinando Paër vertont. Dass die Handlung in Sevilla spielt, ist natürlich der Zensur geschuldet.
Beethoven war ein großer Bewunderer von Luigi Cherubini, dessen dramatische Kraft er schätzte. So weit ging diese Bewunderung, dass Beethoven sich Cherubinis Requiem für seine eigene Trauerfeier wünschte. Auf einer Reise, die Cherubini nach Wien führte, lernte er Beethoven – wie übrigens auch Haydn – persönlich kennen. Cherubini setzte sich daraufhin für die Verbreitung der Musik Beethovens in Frankreich ein.
Luigi Cherubini und sein Requiem in c-Moll
Die Lebenszeit des aus Florenz stammenden Maria Luigi Carlo Zenobio Salvatore Cherubini erstreckte sich über wichtige Epochen der Musikgeschichte. Kaum später als Mozart geboren, reichte sein Leben und Schaffen über die gesamte Wiener Klassik hinweg weit in die frühe Romantik. Nach Studien in Italien strebte der junge Komponist nach europaweiter Anerkennung. Er ging zuerst nach London, wo er mit den Oratorien Georg Friedrich Händels vertraut wurde. 1787 übersiedelte er nach Paris, wo er mit seiner Oper Lodoïska den Durchbruch schaffte.
Es folgten, ebenfalls sehr erfolgreich, Die Wasserträger und Médée. Das sind Titel, die auch heutigen Musikfreunden etwas sagen, zumal das letztgenannte Werk durch Maria Callas in unsere Zeit geholt wurde. Brahms bezeichnete Médée als „höchste dramatische Musik“. Bei diesen Opern ließ sich Cherubini leiten von den Ideen Christoph Willibald Glucks, der Erhabenheit und Schlichtheit einforderte. Mehr Aufmerksamkeit als dieser schenkte Cherubini aber der Ausgestaltung des Orchesterparts.
Leider ließ sich dieser Erfolg nicht fortsetzen, da Napoleon die italienische Oper dem neuen dramatischen Stil vorzog. Auch deshalb geriet Cherubini in eine Schaffenskrise und beschäftigte sich zwei Jahre lang nur mit Botanik und Kartografie. Daraufhin wandte sich Cherubini der Instrumentalmusik und der geistlichen Musik zu und bekleidete bald das Amt des Superintendenten für die Königliche Kirchenmusik. Für die Philharmonische Gesellschaft London schrieb er eine Sinfonie, eine Ouvertüre und ein vierstimmiges Chorwerk. Des Weiteren entstanden ein achtstimmiges Credo, Streichquartette und eine Messe Solemnelle, die umfangreicher ist als die gewaltige Missa solemnis von Beethoven. Cherubini unterrichtete nun am Pariser Konservatorium und wurde bald darauf dessen Direktor. Die Entstehung des Requiems in c-Moll fällt in diese Epoche. Der Anlass für die Komposition war der 23. Jahrestag der Hinrichtung von Ludwig XVI im Jahr 1816. Das Werk fand großen Anklang, jedoch befand der Erzbischof von Paris einige Jahre später, dass es unstatthaft sei, wenn Frauen und Männer in der Kirche gemeinsam in einem Chor singen. So schrieb Cherubini ein weiteres Requiem in d-Moll, in dem nur ein Männerchor besetzt ist.
Gegenüber den großen Requien von Wolfgang Amadé Mozart und Giuseppe Verdi, die heute noch oft erklingen, verwendet Cherubini in seinen beiden Requien keine Solostimmen, vielleicht auch als Tribut an die Schlichtheit, der sich die französische Musik nach Gluck verpflichtet fühlte. Ein wenig vergleichen lässt sich das Requiem in c-Moll von Cherubini mit der anderen großen Totenmesse eines Franzosen. Gemeint ist das Requiem von Charles Gounod, das ebenfalls eine tröstliche Erhabenheit ausstrahlt, weniger jedoch die Schrecken des Dies irae schildert. In unserem Kulturkreis konnten sich Cherubinis Totenmessen im Gegensatz zu denen von Mozart und Verdi kaum durchsetzen.
Collegium Vocale Gent
Sopranos Ulrike Barth, Annelies Brants, Sylvie De Pauw, Malena Napal Porpiglia, Magdalena Podkościelna, Elisabeth Rapp, Chiyuki Riem, Charlotte Schoeters.
Altos Montserrat Bertral, Sterre Decru, Gudrun Köllner, Laura Kriese, Cécile Pilorger, Julia Spies, Matylda Staśto-Kotuła, Sylvia Van Der Vinne.
Tenors Benjamin Aguirre, Malcolm Bennett, Patrik Horňák, Thomas Köll, Carlos Negrin Lopez, Emanuele Petracco, Joseph Taylor, René Veen.
Basses Johannes Dekker, Philipp Kaven, Kurt Lachmann, Christian Nungesser, Marek Opaska, Martin Schicketanz, Giacomo Serra, Bart Vandewege.
Maria Van Nieukerken, Cheffe De Chœur
Anne Bertin-Hugault, Pianiste Préparation Choeur
Orchestre Des Champs-Élysées
Violons 1 : Alessandro Moccia, Ilaria Cusano | Giusy Adiletta, Roberto Anedda, Diane Cesaro, Carlotta Conrado, Pascal Hotellier, Philippe Jegoux, Enrico Tedde.
Violons 2: Corrado Masoni, Solenne Guilbert | Catherine Arnoux, Isabelle Claudet, Jean-Marc Haddad, Chloé Jullian, Andreas Preuss, Sebastian Van Vucht.
Altos: Catherine Puig, Delphine Grimbert | Marie Bretagne, Brigitte Clément, Luigi Moccia, Benoît Weeger.
Violoncelles : Gesine Queyras / Ageet Zweistra, Andrea Pettinau | Vincent Malgrange, Harm-Jan Schwitters, Lena Torre.
Contrebasses : Axel Bouchaux | Damien Guffroy, Miriam Shalinsky, Massimo Tore.
Flûtes : Georges Barthel, Anastasiia Fedchenko
Hautbois : Emmanuel Laporte, Taka Kitazato.
Clarinettes : Álvaro Ibora, Daniele Latini.
Bassons : Julien Debordes, Jean-Louis Fiat.
Cors : Ricardo Rodriguez, Jean-Emmanuel Prou, Marin Duvernois / Frank Clarysse.
Trompettes : Arne Van Eenoo, Yorick Roscam.
Trombones : Harry Ries, Guy Hanssen, Wim Becu.
Timbales : Stefan Gawlick.