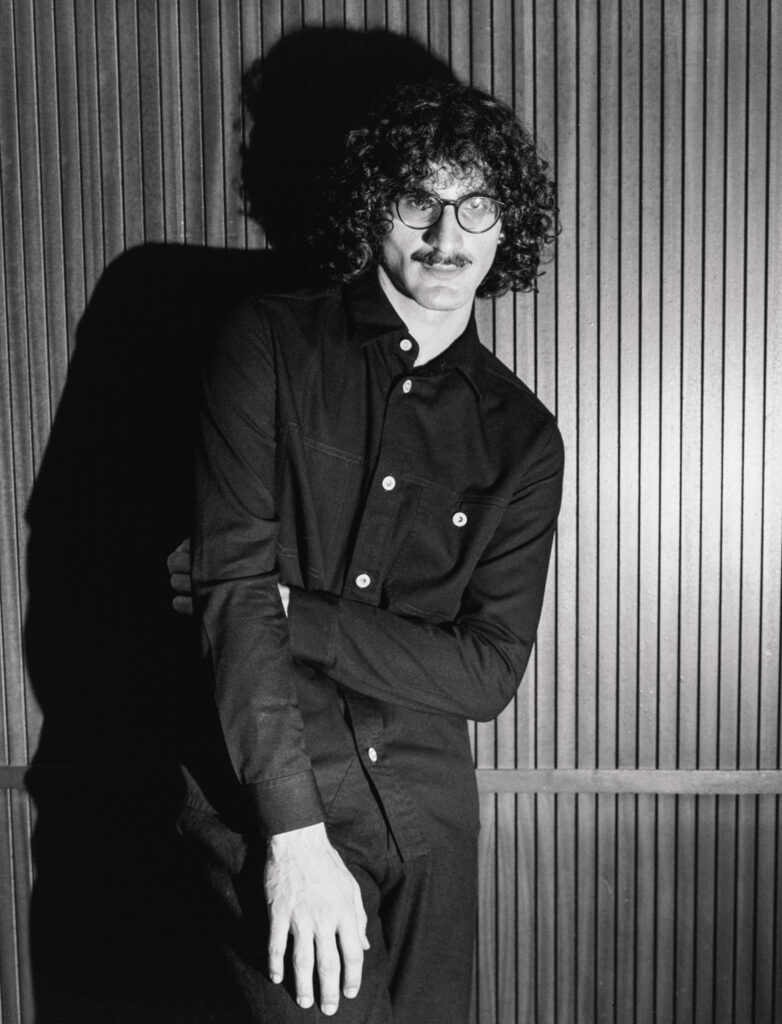18.45 Uhr Konzerteinführung im Saal Bodensee
19.30 Uhr Großer Saal
Das gesamte Jahresprogramm 2025/2026 können Sie hier digital ansehen.
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Sonate für Klavier und Violine Nr. 3 Es-Dur, op. 12 Nr. 3
1. Allegro con spirito
2. Adagio con molta espressione
3. Rondo: Allegro molto
Béla Bartók (1881 – 1945)
Sonate für Violine und Klavier Nr. 1, Sz 75
1. Allegro appassionato
2. Adagio
3. Allegro
Josef Bardanashvili (*1948)
Neues Werk für Violine und Klavier
César Franck (1822 – 1890)
Sonate für Violine und Klavier A-Dur, FWV 8
1. Allegretto ben moderato
2. Allegro
3. Recitativo – Fantasia
4. Allegretto poco mosso
Ludwig van Beethoven
Sonate für Klavier und Violine Nr. 3 Es-Dur, op. 12 Nr. 3
Wie die Sonaten von Mozart heißen auch die frühen Duosonaten von Beethoven noch ausdrücklich „für Klavier und Violine“, was den hohen Anspruch des Klavierparts erklärt. Doch ist die Balance zwischen den beiden Instrumenten schon in den 1798/99 entstandenen ersten drei Sonaten op. 12 sehr weit fortgeschritten. Mozarts Sonaten waren Vorbild; Beethoven greift ihre Form in seinen meist dreisätzigen Sonaten auf, führt sie jedoch von Anfang an in seiner impulsiven Handschrift weiter. Beethoven war mit den Sonaten Mozarts vertraut: Obwohl seine Fertigkeiten auf der Violine nicht so brillant waren wie im Klavierspiel – das sehr virtuos gewesen sein muss –, studierte er sie während seiner Zeit in Bonn.
Die raschen Außensätze der heute Abend erklingenden Es-Dur-Sonate op. 12/3 stehen in ihren Läufen und Figurationen den Sonaten des Salzburger Meisters sehr nahe. Von Anfang an bestimmt ein feiner Dialog von führenden und begleitenden Stimmen das Geschehen. In Beethovens Wanderungen durch die Tonarten, in den kraftvollen Akkorden und sparsam gesetzten Eintrübungen weht freilich auch ein neuer Geist. Eine Art Gesangsszene vor Beginn der Reprise lässt außerdem aufhorchen.
Ungemein ausdrucksstark ist der langsame Mittelsatz, wenn sich der Pianist zunächst mit einer weit gespannten Melodie über die Begleitakkorde der linken Hand erhebt und sich dann die Violinstimme über der markanten Bassfigur des Klaviers verströmt. Wir folgen der sanften Ausweitung der Harmonik, die in einzelnen sforzato-Akzenten vertieft wird, dem Aufbauen und Lösen und den wechselnden Farben, die an die zur gleichen Zeit entstandene Klaviersonate op. 13 „Pathétique“ erinnern. Spielfreudig und musikantisch ist der Finalsatz, ein Rondo, dessen Kontratanz-Thema nach manchmal kühnen und trotzigen Modulationen immer neu aufgegriffen wird und dessen sprudelnde Energie nie nachzulassen scheint. Die Lust an Ausflügen in andere Tonarten bereitete dem Rezensenten der Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung am 5. Juni 1799 übrigens merklich Mühe:
„Es ist unleugbar, Herr van Beethoven geht einen eigenen Gang; aber was ist das für ein bizarrer, mühseliger Gang! Gelehrt, gelehrt und immerfort gelehrt und keine Natur, kein Gesang! Ja, wenn man es genau nimmt, so ist auch nur gelehrte Masse da, ohne gute Methode; eine Sträubigkeit, für die man wenig Interesse fühlt; ein Suchen nach selt’ner Modulation, ein Ekelthun gegen gewöhnliche Verbindung, ein Anhäufen von Schwierigkeit auf Schwierigkeit, dass man alle Geduld und Freude dabey verliert.“
In unseren Ohren klingen Beethovens manchmal abrupte Wendungen heute natürlich längst vertraut in ihrem vorwärts drängenden Duktus – doch durchaus auch überraschend.
Béla Bartók
Sonate für Violine und Klavier Nr. 1, Sz 75
Im Leben und Schaffen des ungarischen Komponisten Béla Bartók (1881–1945) spielte die Volksmusik seiner Heimat und die anderer Länder eine große Rolle. Als Musikethnologe bereiste er gemeinsam mit seinem Kollegen Zoltán Kodály die Balkanländer; die Volksmusikmelodien sind im Original oder stilisiert in Bearbeitungen in seine Werke eingegangen.
Im zarten Alter von fünf Jahren erhielt Béla Bartók den ersten Klavierunterricht von seiner Mutter, auch Kompositionen entstanden bereits früh. Von 1899 bis 1904 studierte er an der Budapester Musikakademie Komposition und Klavier, dabei führte er als Konzertpianist oft eigene Werke auf. Später unterrichtete er selbst an dieser Hochschule. In großer Verbundenheit zu seiner ungarischen Heimat begann er, die echten Volkslieder der Bauern zu sammeln und aufzuzeichnen, und dehnte seine Reisen auch in andere südosteuropäische Länder aus. Volksliedmelodien und Rhythmen sind in viele seiner Werke eingeflossen und verbinden sich mit den neuen Kompositionstechniken seiner Zeit zu einem ganz persönlichen Stil.
Bartók hinterließ viele Werke für Klavier und schuf die mehrbändige Klavierschule Mikrokosmos, die auch heute noch viele Schüler begleitet. Von großer Bedeutung sind auch seine sechs Streichquartette, das Konzert für Orchester oder die Oper Herzog Blaubarts Burg. Im Jahre 1940 zwangen ihn die politischen Umstände in Ungarn zur Auswanderung nach Amerika. Hier entstanden noch das dritte Klavierkonzert und die dem Geiger Yehudi Menuhin gewidmete Sonate für Violine solo, die Bartóks letztes vollendetes Werk ist. Der Komponist starb im amerikanischen Exil in New York an Leukämie. Er ist nicht nur der bedeutendste ungarische Komponist, sondern im Farbenreichtum seiner Werke auch wegweisend für die Musik des 20. Jahrhunderts – obwohl manche seiner Stücke von vielen als sehr aggressiv und schwierig empfunden werden.
Seine beiden Violinsonaten komponierte Bartók Anfang der 1920er-Jahre in einer für ihn schwierigen politischen Situation. Recht kompliziert wirkt mindestens auch der erste Satz der ersten Sonate: Die volksmusikantischen Elemente werden überlagert durch einen zerrissen wirkenden Gestus und zerklüftete Akkorde. Zu Beginn erinnern die Klavierfiguren an ein Zymbal, darüber schwingt sich die Violine mit einer hochexpressiven Linie auf. Zwar legt Bartók eine Sonatenform zugrunde, doch ist sie nur schwer erkennbar. Man wird gefangen von der brodelnden Intensität und der rhythmischen Spannung, die von den akzentuierten Klavierakkorden ausgeht. Dazu kontrastieren klangfarbenreiche Episoden, die an Debussy erinnern und auch gläsern-unwirklich klingen können.
Wie ein feines Gespinst wirkt die Violinstimme im langsamen Satz, sie ist manchmal ganz solistisch oder nur sparsam begleitet. Theodor W. Adorno schrieb über dieses Adagio:
„Die Geige trägt ein lang ausgesponnenes Thema solo vor, das allein genügen sollte, die Behauptung melodischer Impotenz nicht-tonaler Musik Lügen zu strafen…“ Die unwirkliche, friedvolle Stimmung wird freilich von einem wild ausbrechenden, mit rhythmischen Schlägen und die hohen und tiefen Register der Instrumente ausreizenden Finale abgelöst. Wieder sei Adorno zitiert:
„Der dritte Satz ist Rondo capriccioso und Csárdás zugleich, ganz einfach gefügt, merklich nach cis-Moll auslugend, hat er große thematische Prägnanz und synkopischen Reiz.“
Der Satz mag zwar „einfach gefügt“ sein – die Ausführenden aber haben viel zu tun! Bartók komponierte die beiden Sonaten (die zweite ist kürzer und nur zweisätzig) für die Geigerin Jelly d’Arányi, die eine Großnichte des Geigers Joseph Joachim war und mit der der Komponist in Budapest studiert hatte.
Die Uraufführung fand in Wien statt (mit der Geigerin Mary Dickenson-Auner und dem Pianisten Eduard Steuermann). Jelly d’Arányi und Bartók musizierten die Pariser Erstaufführung der Sonate im Rahmen eines festlichen Abendessens im Beisein von Honegger, Milhaud, Ravel, Szymanowski und Strawinsky – führenden Komponisten der Zeit.
Der Mäzen und Kammermusikliebhaber Walter Wilson Cobbett nannte die Sonaten „ungarische Festungen des Klangs“, die nicht für Kammermusikliebhaber, sondern nur für Violinvirtuosen einnehmbar seien – und zwar auch nur für solche, „die ihre Ohren an die Klänge bodenständiger ungarischer Volkslieder gewöhnt haben.“
Josef Bardanashvili
Neues Werk für Violine und Klavier
Der Verlag für Neue Musik Berlin schreibt über seinen Komponisten: Josef Bardanashvili wurde 1948 in Batumi, Georgien, geboren. Er studierte an der Musikakademie in Tiflis bei Aleksandr Shaverzashvili; er schloss sein Studium mit einem Doktortitel in Komposition im Jahr 1976 ab. Bardanashvili war Direktor der Musikhochschule in Batumi (1986 – 1991) und Vize-Minister für Kultur in Adscharien (1993–1994); in dieser Eigenschaft organisierte er zahlreiche internationale Musikfestivals. Im Jahr 1995 zog er nach Israel. Bardanashvili war von 1996 bis 1999 Composer-in-Residence des Raanana Symfonette Orchestra in Israel und Musikdirektor der Internationalen Biennale für Neue Musik „Tempus Fugit“ in Tel Aviv (2002, 2004, 2006). Zurzeit ist er Composer-in-Residence der Israel Camerata Jerusalem. Er lehrte am Camera Obscura College, an der Bar-Ilan-Universität und am Sapir Academic College. Derzeit ist er Mitglied der Fakultät der Hochschule für Musik an der Universität Tel Aviv und der Jerusalem Academy of Music and Dance. Bardanashvili war von 1999 bis 2010 Mitglied des Öffentlichkeitsrates des Ministeriums für Kultur und Kunst in Israel.
Bei Wikipedia ist zu lesen: Josef Bardanashvili komponierte mehr als 100 Werke. Er schrieb Opern und Ballette, darunter eine der ersten georgischen Rock-Opern Alternative (1976) und das Rock-Ballett Tutor (1982), außerdem Orchestermusik wie etwa Sinfonien, sinfonische Dichtungen und Konzerte für Soloinstrumente wie Streicher, Gitarre, Flöte, Mandoline, Klavier oder Klarinette. Hinzu kommen Kammermusik und Vokalwerke sowie Musik für zahlreiche Theaterproduktionen und Filme. Beeinflusst wurde seine Musiksprache von der Polystilistik Alfred Schnittkes und vom Werk seines Landsmanns Gija Kantscheli.
In seinen Kompositionen versucht Bardanashvili eine Synthese der georgischen und jüdischen Kulturen. Er verwendet zeitgenössische Kompositionsmethoden, allerdings in einer freien, undogmatischen Weise. Als Inspiration dienen ihm unterschiedliche literarische Quellen, u. a. die jüdische Poesie des Mittelalters und Texte von Mark Aurel bis Michelangelo. Seine Werke entstanden für verschiedenste Interpreten, Orchester und Dirigenten – und man darf gespannt sein, wie er die Violine von Lisa Batiashvili zum Leuchten und Singen bringt!
César Franck
Sonate für Violine und Klavier, A-Dur FWV 8
César Franck wurde 1822 als Sohn deutscher Eltern in Lüttich (Belgien) geboren und trat gemeinsam mit seinem Geige spielenden Bruder als musikalisches Wunderkind am Klavier auf. 1835 zog die Familie nach Paris, wo César zunächst ein Jahr lang Privatunterricht bei Anton Reicha in Komposition, Kontrapunkt und Fuge nahm, bevor er am Pariser Conservatoire studierte.
Gegen den Willen seines Vaters gab er die Virtuosenlaufbahn auf und wirkte als Lehrer und Organist. 1858 wurde er Kantor und Organist an der Kirche Ste. Clothilde in Paris, eine Stelle, die er bis zu seinem Tod innehatte. Zahlreiche kirchenmusikalische Werke entstanden an der großen Orgel dieser Kirche. 1872 trat er die Nachfolge seines Orgelprofessors am Konservatorium an, wo er eine ganze Generation von Organisten und Komponisten wie Vincent d’Indy oder Louis Vierne ausbildete. Gemeinsam mit Camille Saint-Saëns gründete er 1871 die „Société Nationale de Musique“, die sich für die Aufführungen der Werke junger französischer Komponisten einsetzte – natürlich auch für die eigenen: So wurden die Symphonischen Variationen für Klavier und Orchester, die bekannte d-moll-Symphonie, die Violinsonate und das Klavierquintett erstmals im Rahmen der Konzerte der Société Nationale vorgestellt. Anerkennung als Komponist fand Franck erst mit diesen seinen späteren Werken. In seiner Vermittlerposition zwischen den Komponisten der klassisch-romantischen Perioden in Deutschland und dem Klangfarbenreichtum in der Musik des ausgehenden 19. Jahrhunderts in Frankreich hatte César Franck eine nachhaltige Wirkung auf die französische Musikgeschichte. Die Violinsonate (die es auch in einer Bearbeitung für Violoncello gibt) komponierte Franck im Jahr 1886 im Alter von 63 Jahren und schenkte sie dem berühmten belgischen Geiger Eugène Ysaÿe zur Hochzeit – dieser brachte sie auch am 31. Dezember 1887 im Rahmen der Société Nationale de Musique zur Uraufführung. Wie tastend, fragend hebt das Spiel der Instrumente im ersten Satz an: Zögernd eingeleitet vom Klavier, schwingt sich die Violine zu ihrem großen ersten Thema auf, das sich als „idée fixe“, eine Art Leitmotiv, natürlich auch verwandelt, durch alle vier Sätze ziehen wird. Die Antwort des Klaviers ist zunächst bewegter, aufgewühlter, was den Charakter des Dialogs verändert und bestimmter macht. In weiten Bögen bewegt sich der aufgewühlte zweite Satz: Leidenschaftlich in der hochromantischen Tonsprache, mündet diese Bewegung in einen lyrischen zweiten Teil und einen versunken entrückten dritten Abschnitt, um dann umso mitreißender die emotionale Fülle des Beginns wieder aufzunehmen.
Im dritten Satz halten die Musiker gleichsam Rückschau auf das in den vergangenen Sätzen Gehörte, lassen sich aber auch in der „Fantasia“ von neuen Gedanken davontragen, schwermütig, sinnlich und ganz dem Ausdruck hingegeben.
Der letzte Satz beginnt mit einem Kanon, dessen Thema wiederum aus den bisherigen Themen herausgebildet und zusammengefasst wird: Ausdrucksstark, leidenschaftlich, dabei ungemein gesanglich und groß ausschwingend krönt dieser Satz die ganze Sonate. Das Konzert bei der Uraufführung hatte um drei Uhr nachmittags des Silvestertags 1887 in einem der Säle des Musée Moderne de Peinture in Brüssel begonnen. Aus Angst, die Gemälde könnten beschädigt werden, erlaubte die Verwaltung keine Verwendung von Kerzen oder Gaslampen, und als das Nachmittagslicht allmählich nachließ, wurde es für die Ausführenden immer schwieriger, die Noten zu lesen. Mit dem beherzten Schlachtruf „Allons!“ spornte Ysaÿe seine Klavierpartnerin Léontine Marie Bordes-Pène dazu an, immer schneller und zunehmend aus dem Gedächtnis zu spielen – die Leidenschaftlichkeit der Sonate wurde dadurch sicher noch gesteigert!